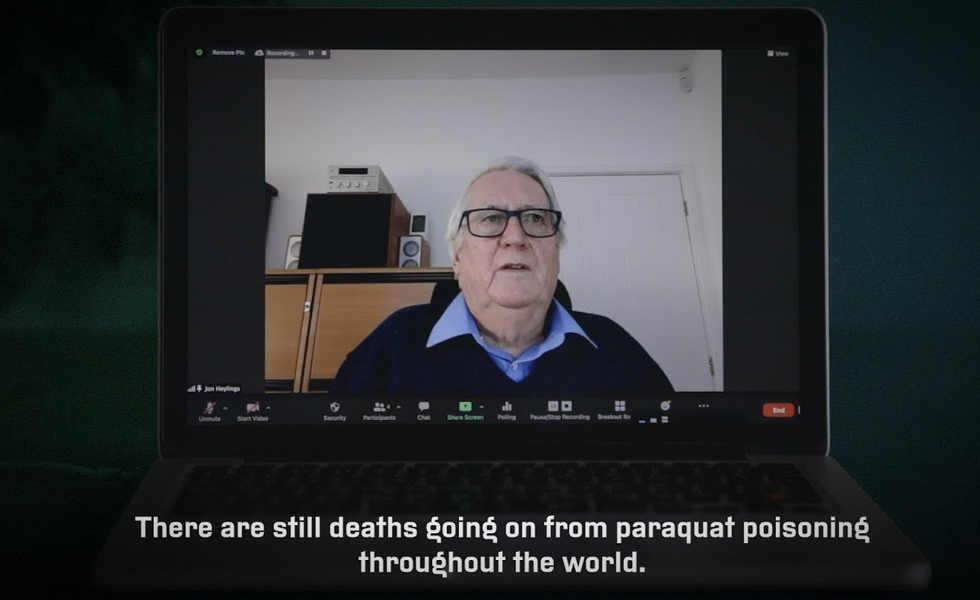Paraquat Papers Wie Syngenta jahrzehntelang Warnungen ignorierte, um sein hochgiftiges Pestizid im Markt zu halten
Laurent Gaberell, 24. März 2021
Warunika war sechzehn Jahre alt, als sie einen Schluck «Gramoxone» aus einer Flasche trank, die im Haus ihrer Familie herumstand. Ihre Eltern sind sich sicher: Sie wollte nicht sterben.
Nach einem Streit mit ihrem Bruder hatte sie sich wütend die Flasche geschnappt und einen Schluck genommen. «Hier, ich hab das getrunken!», rief sie ihrer Mutter zu. «Sie hat das getan, um mir Angst zu machen», erklärt Kumarihami.
Warunika starb am nächsten Tag im Krankenhaus.
 ©
Sachindra Perera
©
Sachindra Perera
Ihre Eltern, Kleinbauern im Norden Sri Lankas, benutzten Gramoxone als Unkrautvernichter auf ihren Reisfeldern. Das Produkt enthält Paraquat – eines der giftigsten Herbizide der Welt – in hoher Konzentration.
Bereits ein Schluck kann tödlich sein, und ein Gegenmittel gibt es nicht.
Zur Zeit als Warunika starb – vor rund 20 Jahren – tötete Paraquat jedes Jahr Hunderte von Menschen in Sri Lanka.
Niemand weiss, wie viele Menschen insgesamt durch das Schlucken der Chemikalie gestorben sind, seit die britische Firma Imperial Chemical Industries (ICI) Gramoxone 1962 auf den Markt brachte. Aber laut Michael Eddleston, Professor für klinische Toxikologie an der Universität Edinburgh und einer der weltweit führenden Experten für Pestizidvergiftungen, sind es Zehntausende – mindestens. In Ländern aller Weltregionen – von den Vereinigten Staaten über Trinidad, Brasilien, Costa Rica oder Malaysia bis zu Südafrika oder Indien – kam es zu tödlichen Vergiftungen durch Paraquat.
Zahlreiche Menschen sind unter ähnlichen Umständen ums Leben gekommen wie Warunika – als Folge einer impulsiven Handlung in einem Moment der Not.
Und viele Kinder sind gestorben, nachdem sie versehentlich einen Schluck Paraquat zu sich genommen hatten.
Die Einnahme des Herbizids endet fast immer tödlich. Deshalb ist es mittlerweile in über 50 Ländern verboten. Sri Lanka hat 2008 ein Paraquatverbot beschlossen, einige Jahre nach Warunikas Tod.
Sechs Jahrzehnte der Verantwortungslosigkeit
 ©
Mark Henley / Panos Pictures
©
Mark Henley / Panos Pictures
Syngenta, der Schweizer Riese in chinesischen Händen, hat das Pestizidgeschäft von ICI geerbt (ICI wurde in den 1990ern in Zeneca umbenannt und 2000 ein Teil von Syngenta), und exportiert noch heute jedes Jahr Tausende Tonnen Paraquat aus seinem Werk in Nordengland – obwohl die Verwendung des Herbizids sowohl in Grossbritannien wie in der Schweiz verboten ist.
Das Unternehmen beteuert, Paraquat sei ein «sicheres und effektives Herbizid», solange es gemäss den Anweisungen auf dem Etikett verwendet werde. Man habe dazu beigetragen, «das Problem der versehentlichen Einnahme» zu lösen: durch die Beigabe eines blauen Farbstoffes und eines Geruchsmittels, um vor einem versehentlichen Trinken abzuhalten, sowie eines Brechmittels. Auf unsere Anfrage schreibt der Konzern, er sei «seit der Erfindung» von Paraquat die «treibende Kraft» hinter seiner «kontinuierlichen Verbesserung» gewesen. Dabei hätte er sich stets «an den besten wissenschaftlichen und medizinischen Standpunkten orientiert».
Doch nun hat eine Klage gegen Syngenta in den USA eine Fülle an internen Dokumenten ans Licht gebracht, die diese schönen Worte als leere Phrasen entlarven. Public Eye und Unearthed, die Investigativabteilung von Greenpeace in Grossbritannien, haben in den letzten Monaten Hunderte von Seiten interner Korrespondenz unter die Lupe genommen. Sie zeigen: Syngenta und seine Vorgängerunternehmen wissen seit Jahrzehnten, dass das Brechmittel, das Gramoxone zugesetzt wird, Todesfälle durch Vergiftungen nicht verhindern kann. Trotzdem liessen sie diverse Aufsichtsbehörden während all den Jahren im Glauben, dass das Mittel Leben rette – aus rein kommerziellen Interessen.
Die Dokumente zeigen, dass ICI sein patentiertes Brechmittel erfolgreich nutzte, um erstens seinen Bestseller auf dem Markt zu halten, als wichtige Länder mit einem Verbot drohten, und zweitens die Konkurrenz durch andere Paraquat-Hersteller abzuwehren.
Syngenta und seine Vorgänger ignorierten wiederholt die Warnungen ihrer eigenen Wissenschaftler. Und sie lehnten die flächendeckende Einführung von sichereren Paraquat-Produkten vehement ab, weil sie darin keine «wirtschaftlich akzeptable Lösung für das Suizidproblem» sahen.
Klage in den USA
In den USA hat die Kanzlei Korein Tillery im Namen einer Gruppe von Landwirt*innen, die Paraquat für ihre Parkinsonerkrankung verantwortlich machen, eine Klage gegen Syngenta eingereicht. Public Eye und Unearthed haben während Monaten Hunderte von Dokumenten gesichtet, die Syngenta im Rahmen des Rechtsstreits offenlegen musste. Die Brechmittel-Episode werde im Verfahren thematisiert, kündet Stephen Tillery, der leitende Anwalt, an. Denn sie zeige, «wie weit die Firma bereit ist zu gehen, um Paraquat auf dem Markt zu halten»
Dass diese Geschichte erzählt werden kann, ist vor allem der Beharrlichkeit des britischen Wissenschaftlers Jon Heylings zu verdanken.
 ©
Unearthed
©
Unearthed
Heylings, der heute Professor für Toxikologie an der Keele University ist, hat während 22 Jahren für ICI, deren Nachfolgefirma Zeneca und schliesslich Syngenta gearbeitet. Er hat dort die Arbeit zur Entwicklung von sichereren Paraquat-Produkten geleitet.
Heylings prangert nun öffentlich an, was er seinen Vorgesetzten seit dreissig Jahren immer wieder gesagt hat: Die Standard-Variante von Gramoxone, die Syngenta bis heute in vielen Ländern verkauft, sei zu gefährlich. Gemäss Heylings ist die Menge des Brechmittels PP796, die dem Produkt beigefügt wird, viel zu niedrig, um nach Einnahme einer tödlichen Dosis schnell genug Erbrechen auszulösen.
Heylings sagt, die Dosierung des Brechmittels beruhe ausschliesslich auf Berechnungen aus einem höchst zweifelhaften internen Bericht, der 1976 von dem mittlerweile verstorbenen ICI-Toxikologen Michael Rose verfasst wurde. Der Wissenschaftler habe Daten aus einer klinischen Studie manipuliert («fabricated»), um nahezulegen, dass Menschen viel empfindlicher auf PP796 reagieren würden als die drei Tierarten, an denen das Mittel getestet worden war.
Als Heylings 1990 die Mängel des Rose-Berichts entdeckte, informierte er seine Vorgesetzten. In einer Reihe von Memos legte er detailliert dar, wie Roses Arbeit das Unternehmen auf Abwege gebracht habe. Eine starke Erhöhung der Brechmittel-Dosis könne «die Zahl der Todesfälle durch Paraquatvergiftungen reduzieren», schrieb er.
Doch dreissig Jahre später produziert Syngenta noch immer Gramoxone mit derselben geringen Konzentration desselben Brechmittels.
 ©
PAN India
©
PAN India
Schlimmer noch: Der weltgrößte Pestizidhersteller konnte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) sogar dazu bringen, seine PP796-Dosierung zum globalen Standard für sämtliche Paraquat-Produkte zu erklären.
Als Heylings dies 2018 erfährt, schlägt er erneut Alarm. Er wendet sich zunächst an Syngenta und anschliessend an die FAO und die US-Umweltschutzbehörde (EPA). «Ich habe nichts gegen Syngenta», schreibt er 2019 in einer E-Mail an die FAO. «Ich möchte nur, dass das nächste Kind, das versehentlich einen Schluck Paraquat nimmt, eine Überlebenschance hat, indem es das Gift erbricht, bevor eine tödliche Dosis ins Blut gelangt und es an Lungenversagen stirbt.»
Die Antwort von Syngenta
Mit den durch Public Eye und Unearthed aufgedeckten Fakten konfrontiert, weist der Basler Konzern «jede Andeutung zurück», dass Syngenta und seine Vorgängerfirmen bei der Entwicklung dieses Produkts «irgendeine andere Absicht» gehabt hätten, als «die richtige Menge an Brechmittel für Paraquat zu ermitteln, um das Risiko einer versehentlichen oder absichtlichen Einnahme bestmöglich zu mindern». Die vorherrschende medizinische Meinung habe sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Heute sprächen sich «angesehene medizinische Experten gegen hohe Dosen von Brechmitteln aus», weil sie befürchteten, dass diese die Toxizität gar erhöhen könnten.
Syngenta schreibt weiter: «Fast alle modernen Innovationen – Gebäude, Brücken, Eisenbahnen, Pharmazeutika, Autos, Maschinen und Pflanzenschutzmittel – sind für Suizide benutzt worden». Die Gesellschaft sollte sich «auf die Probleme der psychischen Gesundheit konzentrieren, anstatt der Welt nützliche Technologien vorzuenthalten (…)».
Die FAO teilt Public Eye und Unearthed mit, dass sie aufgrund von Heylings’ Bedenken eine «Sondersitzung» abgehalten habe, um ihre Spezifikationen zu Paraquat zu überarbeiten. Der Bericht dieser Sitzung werde «derzeit fertiggestellt».
Hier finden Sie die vollständigen Antworten von Syngenta und Chevron.
Wir schreiben das Jahr 1986, als Heylings in ICI’s Zentralem Toxikologischen Labor (CTL) im britischen Cheshire die Arbeit aufnimmt. Schon damals ist das Geschäft mit Paraquat äusserst profitabel. Das Herbizid macht 30% von ICI’s Pestizidumsätzen aus und generiert 30% des Gewinns.
Doch die hohe Zahl der Menschen, die an einer Paraquatvergiftung sterben, bringt diese Profite in Gefahr. ICI schätzt damals die jährliche Zahl der Todesfälle auf 2000 und den Anteil der Suizide auf 95%. Wenig überraschend steht Paraquat «unter zunehmendem Druck von Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt, insbesondere in Westeuropa, Japan und Malaysia», wie ICI damals festhält.
Die Firmenprotokolle zeigen, dass ICI nicht nur gegen die drohenden Verkaufsverbote oder -einschränkungen kämpfte, sondern auch gegen die Bemühungen der Aufsichtsbehörden, sie dazu zu verpflichten, die hochkonzentrierte Flüssigkeit zu verdünnen oder durch festes Granulat zu ersetzen, um das Produkt sicherer zu machen. Dies, obwohl ICI für den britischen Markt seit den 1970er Jahren feste und weniger konzentrierte Paraquat-Herbizide hergestellt hatte und wusste, dass diese deutlich weniger gefährlich waren als Gramoxone. Gemäss einer internen Erhebung aus den 1980er Jahren lag die Todesrate in Grossbritannien bei Vergiftungen durch Gramoxone bei 78%, im Vergleich zu 16% bei festen Paraquat-Produkten wie Weedol.
Aber um Granulate im grösseren Stil zu vermarkten, hätte das Unternehmen in neue, «unerschwingliche» Produktionsanlagen investieren müssen. Und eine Verdünnung des Produkts hätte die Herstellungs- und Verpackungskosten erhöht. Ein Strategiepapier von 1987 bringt die Interessensabwägungen der Firma auf den Punkt: Eine Verdünnung könne zwar eine «messbare Erhöhung der Überlebensrate» bewirken, doch die Paraquat-Konzentration müsste dazu mindestens fünfmal geringer sein. Die weltweite Einführung von verdünnten oder granulierten Produkten würde «die Konzerngewinne durch Paraquat zerstören».

«Keine der derzeit verfügbaren alternativen Produkte bietet eine wirtschaftlich akzeptable Lösung für das Suizidproblem» steht in einem internen Dokument von 1988. Die Firma ist der Meinung, sie sei ihrer Verantwortung für eine «Minimierung versehentlicher Vergiftungen» nachgekommen, indem sie Gramoxone in den 1970er Jahren einen Farbstoff, ein Geruch- und ein Brechmittel hinzugefügt habe. Für das «soziale Problem» der Selbsttötungen fühlt sie sich nicht zuständig.
ICI ist sich jedoch bewusst, dass Regulierungsbehörden diese Ansicht nicht unbedingt teilen würden. Deshalb veranlasst das Management eine reaktive Strategie, um das «kommerzielle» Problem durch den «Missbrauch unseres Produkts bei Suizidversuchen» zu beheben: die «Entwicklung alternativer Produktformulierungen» auf «Reserve». Diese sichereren Produkte sollen nur dort verkauft werden, wo ICI mit «einer regulatorischen Paraquat-Krise konfrontiert» ist, die zu einem Verbot des Herbizids führen könnte.
Während Jon Heylings an der Entwicklung dieser sichereren Paraquat-Produkte arbeitet, stösst er erstmals auf Ungereimtheiten.
Auf der Suche nach einer wissenschaftlichen Grundlage für die Dosierung des Brechmittels in Gramoxone landet er bei jenem Papier, das am Anfang des Skandals steht: ebendiesem Rose-Report von 1976.
Der Toxikologe Michael Rose empfiehlt darin, Gramoxone 5 mg des Brechmittels PP796 pro 10 ml Flüssigkeit beizumischen. Er schätzt, dass diese Menge ausreicht, um bei «der Mehrheit» derjenigen, die die minimale tödliche Dosis Paraquat schluckten, Erbrechen auszulösen. Alle Tierversuche von ICI legten allerdings nahe, dass dazu eine viel höhere Dosis erforderlich wäre. Doch Rose erklärte, Menschen reagierten «empfindlicher auf die emetische Wirkung von PP796 als die untersuchten Labortiere». Wie war er zu diesem Schluss gekommen?
PP796 wurde ursprünglich nicht als Brechmittel, sondern als Asthma-Medikament entwickelt. Da frühe klinische Studien unangenehme Nebenwirkungen einschliesslich Erbrechen zeigten, wurde es als solches bald wieder verworfen. Die Ergebnisse dieser Tests waren die einzigen Informationen über die Wirkung von PP796 als Brechmittel bei Menschen, über die ICI verfügte. Auf ihrer Grundlage hatte Rose die zum Erbrechen notwendige Dosis abgeschätzt.
Heylings besorgt sich die Originaldaten der Studie und vergleicht sie mit Roses Bericht. Zu seiner Überraschung kann er «die beiden Datensätze nicht miteinander in Einklang bringen». Er stellt fest, dass Rose seine Aussagen auf einen winzigen klinischen Versuch stützte, der nur zwölf Proband*innen umfasste, von denen sich gerade mal zwei übergeben hatten. Für Heylings steht fest, dass Rose diese Daten für seinen Bericht manipuliert hat: Er schloss Personen aus, die durch PP696 nicht erbrochen hatten, und fügte stattdessen Teilnehmer*innen aus einer anderen Studie hinzu. Und damit nicht genug: Rose stützte seine gesamte Argumentation darauf ab, dass eine Person, die 8mg PP696 erhalten hatte, sich nach zwei Stunden übergeben musste – viel zu spät, als dass dadurch eine tödliche Paraquatvergiftung hätte verhindert werden können.

Im Januar 1990 teilt Heylings seine Bedenken in einem Memo erstmals seinem Chef, dem Toxikologen Lewis Smith, mit: Studien zu Vergiftungsfällen durch Paraquat-Produkte mit Brechmittel hätten «keinen eindeutigen Beweis dafür erbracht», dass die Beimischung von 5mg pro 10 ml (oder 0,05%) PP796 in Gramoxone in den 1970er Jahren «zu einem signifikanten Rückgang der Zahl der Todesfälle geführt hat», schreibt Heylings. Aus seiner Sicht sei das «nicht besonders überraschend». Er sei zum Schluss gekommen, dass «die empfohlene Konzentration an PP796 wahrscheinlich weit unter einer beim Menschen wirksamen Dosis liegt».

Die von Rose verwendeten Daten seien «nicht ausreichend», um wissenschaftlich zu belegen, dass Menschen empfindlicher auf PP696 reagierten als Tiere, schreibt Heylings. Um die Zahl der tödlichen Vergiftungen zu reduzieren, müsste die Konzentration des Brechmittels «um das Zehnfache erhöht werden».
Heylings ist nicht der erste, der eine deutliche Erhöhung des Brechmittels fordert. Auch Lewis Smith selbst, der später Leiter Produktentwicklung bei Syngenta in Basel wurde, hatte bereits 1985 eine fünffache Erhöhung der Brechmittel-Dosis empfohlen. Bei einem Austausch zwischen den beiden im Herbst 1990 versichert Smith Heylings, es gebe «keinerlei Meinungsverschiedenheiten» zwischen ihnen darüber, dass «eine drei- bis fünffache Erhöhung des Brechmittels in Betracht gezogen werden sollte». Doch Smith hat offensichtlich keine Lust, in der Vergangenheit zu wühlen. Er rät Heylings, sich stattdessen darauf zu konzentrieren, eine Lösung zu finden.
Hätte man ihm erlaubt, der Sache auf den Grund zu gehen, hätte Heylings vielleicht entdeckt, dass viele der Fehler in Roses Bericht bereits fünfzehn Jahre zuvor erkannt worden waren.
Michael Rose beginnt 1976 für ICI in Cheshire an einem Brechmittel für Paraquat zu arbeiten. Denn das Pestizid wird für die Firma allmählich zum Problem: Seit einigen Jahren steigt die Zahl der tödlichen Vergiftungen in Grossbritannien konstant an. Der Hersteller steht zunehmend im Fadenkreuz der Medien, der Aufsichtsbehörde und der ohnmächtigen Ärzte, die im Fall einer Vergiftung nichts tun können.
Internen Dokumenten zufolge steht ICI auch in anderen Teilen der Welt wie Japan, Malaysia und Westeuropa unter «starkem Druck» der Regulierungsbehörden. Die grösste Bedrohung geht von den Vereinigten Staaten aus. Denn die US-Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency EPA) hat 1975 neue Regeln erlassen, wonach sehr risikoreiche Pestizide umfassend auf ein mögliches Verbot hin überprüft werden können.
Das Verfahren kann unter anderem auf Pestizide angewandt werden, für die es im Notfall kein Gegenmittel gibt. Die Chevron Chemical Company, die Paraquat in den Vereinigten Staaten für ICI vertreibt, schreibt in einem Brief im Dezember 1975 an ICI, das Herbizid laufe Gefahr, einer solchen Überprüfung unterzogen zu werden.
Teile der EPA wollten Paraquat «drankriegen».
Nun ist schnelles Handeln angesagt; denn ein Verbot in den USA käme ICI teuer zu stehen und könnte zudem andere Märkte gefährden. Im folgenden Monat wird Michael Rose gebeten, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich mit der «Machbarkeit» der Zugabe eines Brechmittels zu Gramoxone befasst. Bereits bei ihrem ersten Treffen am 29. Januar 1976 kürt die Gruppe ihren Kandidaten: PP796.

Im August schickt ICI einen Zwischenbericht an Chevron: Eine Dosis von «5 mg pro 10 ml Gramoxone» löse «wahrscheinlich bei 80% derjenigen, die eine solche Menge einnehmen, innerhalb von 15 Minuten Erbrechen aus», steht dort. Doch der Toxikologe Richard Cavalli von Chevron stellt dies in Frage. Nach einigen Nachforschungen gelangt er zum exakt gleichen Schluss, den vierzehn Jahre später auch Jon Heylings ziehen wird: Die Daten stützten die mündlichen Aussagen aus dem Toxikologischen Labor von ICI nicht, wonach «das Präparat beim Menschen wirksamer sei».
Cavalli äussert seine Bedenken auch in einem an Rose adressierten Schreiben. Rose räumt daraufhin ein, dass die klinischen Daten «sicherlich schwach» seien. Er habe «mangels harter Beweise einen Berichts-Entwurf gemacht», in dem er sich für die Zugabe von 5mg pro 10ml ausspreche. Er schliesst: «Wir glauben, dies sollte ausreichen, um in Europa die Zulassung zu erhalten. Kommentare?»
Bis im Herbst 1976 korrigiert Rose seine eigenen Aussagen sukzessive: In seinem Abschlussbericht sind es schliesslich nicht mehr 80% der Menschen, die angeblich bei 5mg Brechmittel nach 15 Minuten erbrechen, sondern nur noch «eine Mehrheit», die «innerhalb einer Stunde» erbricht.
Dennoch stimmt der ICI-Vorstand Roses Vorschlag im Oktober zu und beschliesst, Gramoxone weltweit pro 10ml Flüssigkeit 5mg des Brechmittels PP796 beizufügen, und zwar «so schnell wie möglich». Im April des folgenden Jahres beantragt Chevron bei der US-Umweltbehörde EPA, die Verwendung von PP796 in Paraquat zu erlauben.

Trotz der schwachen Beweislage hofft ICI, die Aufsichtsbehörden weltweit davon zu überzeugen, dass das neue Produkt «einen grossen Fortschritt» in seinen Bemühungen darstelle, «das Vergiftungsproblem zu lösen». So steht es in einem Dokument des Verwaltungsrats, das im Oktober 1976 an die Direktion geht.
Doch neben dem Ziel, die Aufsichtsbehörden milde zu stimmen, verfolgt ICI mit PP796 noch andere Absichten. Die Firma will ihr patentiertes Brechmittel nutzen, um die Konkurrenz durch Hersteller von generischem Paraquat auszuschalten. Der Verwaltungsrat empfiehlt, dass alle ICI-Tochtergesellschaften im Ausland umgehend das Gespräch mit nationalen Aufsichtsbehörden suchen, um sicherzustellen, dass nur noch das Produkt mit dem Brechmittel «verkauft werden darf».
Die Strategie zahlt sich aus. In einem als «geheim» bezeichneten Memo vom August 1981 heisst es, «die Vorschrift, dass Paraquat ein Brechmittel zugefügt werden muss» habe dem neuen Gramoxone in Grossbritannien, Frankreich, Australien, Neuseeland, Japan und Venezuela «eine praktisch exklusive Stellung verschafft».
In einigen Ländern, etwa Frankreich und Venezuela, habe das Brechmittel zudem wahrscheinlich «ein Verbot von Paraquat verhindert».

Im Frühjahr 1982, fünf Jahre nach ICI’s Antrag, genehmigt die EPA schliesslich die Verwendung von PP796 in den USA. Ausserdem verzichtet die Umweltbehörde auf eine Überprüfung der Zulassung von Paraquat. Das Brechmittel hat bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt, wie aus einem Schreiben der EPA an Chevron hervorgeht.
Diese Neuigkeiten aus den USA sind für ICI in der Zeit wohl die einzigen guten Nachrichten. Die Resultate von Umfragen in zwei Ländern, in denen das neue Gramoxone eingeführt worden ist, sind katastrophal. Gemäss einem geheimen Memo vom August 1981 gibt es «keine statistischen Beweise, dass das Brechmittel die Zahl der Todesfälle durch das Pestizid reduziert hat». Im besten Fall hätten «einige wenige Menschen dank dem zugefügten Brechmittel eine Paraquat-Vergiftung überlebt», und selbst in diesen Fällen «können wir nicht sicher sein», dass PP796 «dazu beigetragen hat, Leben zu retten». Auf die Firma könnte eine «ernsthafte Bedrohung» zukommen, wenn die Behörden in gewissen Ländern vielleicht bald «Beweise für die Wirksamkeit» verlangten, wird im Memo gewarnt. «In einigen Fällen ist es sogar denkbar, dass unser Unvermögen, nachzuweisen, dass das Brechmittel die Anzahl Todesfälle durch Paraquatvergiftungen reduziert, zu einem Verbot des Produkts führen könnte.»
 ©
academia.edu / Andrew Revkin
©
academia.edu / Andrew Revkin
Auch die Chancen, dass ICI seinen kommerziellen Vorteil durch PP796 aufrechterhalten kann, stehen laut Memo schlecht: Angesichts der «aktuellen Einschätzung des wahrscheinlich geringen toxikologischen Nutzens», der sich durch die Zugabe des Brechmittels ergebe, sei derzeit «schwer vorstellbar», wie die Behörden dazu gebracht werden könnten, PP796 in allen Paraquat-Produkten verbindlich vorzuschreiben. Doch nur so könne «durch das Brechmittel ein kommerzieller Vorteil erreicht werden».
Diese Einschätzung ist allerdings deutlich zu pessimistisch, wie sich herausstellt: In den folgenden Jahren gelingt es der Firma, mehrere Länder davon zu überzeugen, das Brechmittel obligatorisch zu machen.
Obwohl das Unternehmen, das 1993 in Zeneca Agrochemicals umbenannt wird, längst um die mangelnde Wirksamkeit seines Brechmittels weiss, weibelt es bei Aufsichtsbehörden weiterhin damit, um Paraquatverbote zu verhindern und sich die Konkurrenz vom Hals zu halten. Als die Europäische Union die Zulassung von Paraquat Anfang der 1990er Jahre überprüft, will Zeneca die Gelegenheit nutzen, um PP796 «in allen in der EU vermarkteten Paraquat-Produkten obligatorisch zu machen».
Der Zeneca-Mitarbeiter Andy Cook, heute Globaler Leiter Regulierung bei Syngenta, erarbeitet für die europäischen Behörden einen Bericht über PP796. Als Heylings am Zentralen Toxikologischen Labor eine Kopie erhält, traut er seinen Augen nicht: Noch immer wird der Bericht von Rose von 1976 als Beweis für die Wirksamkeit der in Gramoxone enthaltenen Brechmittel-Dosis verwendet. Heylings wendet sich an Cook, um seine bereits 1990 angebrachte Kritik zu wiederholen. Trotzdem zitiert Zeneca auch in der bei der EU eingereichten Endfassung den Rose-Bericht.
Zwei Jahre später, im Juni 1997, richtet sich eine Zeneca-Mitarbeiterin mit der Anfrage an Cook, ob Zeneca «eine Art ‹To Whom It May Concern›-Brief» vorlegen könnte, der bestätige, dass das Brechmittel in Gramoxone die Vorgaben der FAO erfüllt. Die FAO hatte gerade neue «Spezifikationen» herausgegeben, wonach Paraquat ein wirksames Brechmittel beigefügt werden soll.
Der Grund für ihre Anfrage sei, dass Nigeria derzeit auf ein Verbot zuzusteuern scheine, während man sich mit Gramoxone auf eine lukrative Ausschreibung bewerben wolle: «richtig viel Geld, wenn wir es kriegen».

2003 schliesslich gelingt es dem Unternehmen, das zur Jahrtausendwende zu Syngenta geworden ist, die FAO davon zu überzeugen, PP796 in ihrer Spezifikation als «einzige Substanz» aufzuführen, welche die Anforderungen an ein Brechmittel für Paraquat erfüllt. Die neue Spezifikation legt die gleiche unwirksame Konzentration an Brechmittel fest, die seit Ende der 1970er Jahre in Gramoxone enthalten ist.
Zudem erneuert die Europäische Kommission im selben Jahr gleich auch noch die Zulassung von Paraquat und schreibt vor, dass alle in der EU vermarkteten Produkte ein «wirksames Brechmittel» enthalten müssten, das den Vorgaben der FAO entspreche.
In den 1990er Jahren konzentriert sich Heylings darauf, die Gefährlichkeit von Paraquat zu reduzieren; durch Brechmittel sowie mithilfe anderer Zusatzstoffe, welche die Absorption des Gifts im menschlichen Körper verlangsamen.
Doch sobald der Toxikologe beginnt, mit Rezepturen zu experimentieren, die die fünffache Menge an Brechmittel enthalten, stösst er intern auf Widerstand. Der Grund: zu teuer.
Jede «signifikante Erhöhung der Brechmittelkonzentration würde eine hohe finanzielle Einbusse mit sich bringen», warnt ihn der Leiter der Herbizidabteilung Ende 1990. Von da an konzentriert sich Heylings' Arbeit auf Produkte mit einer dreifachen Menge an Brechmittel und anderen Zusatzstoffen.
Nach jahrelangem Experimentieren und Versuchen mit verschiedenen Produkten entscheidet sich Syngenta schliesslich in den frühen 2000er Jahren, eines dieser Produkte auf den Markt zu bringen: «Gramoxone Inteon». Syngenta hat Grosses vor mit dem neuen Produkt, das intern als «die Prometheus-Technologie» gehandelt wird. Ein «hochvertrauliches» Projekt-Briefing von 2001 zeigt, dass ICI in Inteon eine «einmalige Gelegenheit» sieht, das «Markenimage» und die «Wahrnehmung von Gramoxone durch wichtige Interessensgruppen» zu verbessern.
Ein Strategiepapier von 2003 zeigt, dass der Konzern auch nach der Zulassung von Inteon – ähnlich wie bereits in den 1970er Jahren – wieder versuchen will, sich «einen legitimen Vorteil gegenüber Konkurrenten» zu verschaffen, indem er «das Produkt zum neuen Mindeststandard für Paraquat etabliert».
Im Oktober 2004 wird Inteon in Sri Lanka eingeführt, wo Paraquat damals 400 bis 500 Todesfälle pro Jahr verursacht. Laut einer später publizierten, von Syngenta finanzierten Studie erhöht das neue Produkt die Überlebensrate von 27,1% auf 36,7%. Über den 16-monatigen Studienzeitraum hat Inteon gemäss der Studie etwa 30 Menschenleben gerettet.

Für mehr als 60% derjenigen, die es eingenommen haben, ist das Produkt aber immer noch tödlich – eine untragbare Bilanz für die sri-lankischen Behörden.
2008 beschliesst Sri Lanka, Paraquat schrittweise vom Markt zu nehmen. 2014 wird es vollständig verboten.
Unterdessen hat Syngenta auch in den USA Mühe, die Umweltbehörde von Inteon’s Vorzügen zu überzeugen. Die Firma versucht die EPA dazu zu drängen, Generikaherstellern die Vermarktung von «älteren Paraquat-Produkten» zu verbieten, weil diese die Sicherheit «unangemessen und signifikant» beeinträchtigten – ohne Erfolg.
So beschliesst Syngenta Anfang 2008, «das Inteon-Projekt zu beenden». In den USA führt die Firma eine andere Paraquat-Variante ein, die auch dreimal mehr Brechmittel als Standard-Gramoxone enthält.
In anderen Ländern – etwa in Indien – verkauft der Basler Konzern weiterhin «Standard»-Gramoxone mit der seit den 1970er Jahren unveränderten Menge an Brechmittel.
Als Jon Heylings 2018 feststellt, dass die FAO immer noch denselben Standard verwendet, schickt er im August eine E-Mail an seine ehemaligen Kollegen bei Syngenta. Während den nächsten 12 Monaten kommt es zu zahlreichen Besprechungen und E-Mails. Der Toxikologe legt seine Kritikpunkte detailliert dar und zeigt auf, wie diese in der Vergangenheit systematisch ignoriert worden sind.
Im Mai 2019 antwortet Dave French, bei Syngenta auf globaler Ebene für Regulierungsfragen verantwortlich, Heylings in einem Brief.
ICI und Rose hätten «kein denkbares Motiv» gehabt, den Bericht von 1976 «zu fälschen oder Daten zu fabrizieren», schrieb er zum Vorwurf der Fälschung.
Die freiwilligen Massnahmen zur Produktesicherheit hätten «eindeutig auf eine Verbesserung der Überlebensrate» abgezielt.
2019 unterzieht Syngenta die Daten des Rose-Berichts erneut einer statistischen Analyse. Diese bestätigt, was Heylings seit 1990 sagt: «Die klinischen Daten lassen keine gesicherte Schlussfolgerung über die angemessene Dosierung von PP796 in Paraquat-Produkten zu», so das Fazit. Syngenta stellt sich auf den Standpunkt, dies sei nicht relevant, weil mittlerweile neue Studien im Besitz des Unternehmens die Wirksamkeit des Brechmittels unter realen Bedingungen belegen würden. Dave French verweist auf eine 1987 veröffentlichte Studie von Meredith und Vale. Diese beweise, dass Gramoxone die FAO-Spezifikationen erfülle.
Diese Studie besage, dass 65% der Personen, die Gramoxone mit PP796 zu sich nahmen, «innerhalb von 30 Minuten erbrechen mussten», schreibt French. Diese Zahlen stammen von einer von ICI finanzierten Studie mit britischen Paraquat-Vergiftungsopfern von 1980 bis 1982.
Public Eye und Unearthed konnten sich die Studie, die nie veröffentlicht wurde, im Detail ansehen. Dabei entdeckten wir Überraschendes:
Die meisten Proband*innen hatten gar kein Gramoxone eingenommen, sondern Weedol, ein weniger konzentriertes, festes Produkt mit einem höheren Brechmittelanteil.

Wir haben die Studiendaten dem Toxikologieprofessor und Experte für Pestizidvergiftungen Michael Eddleston gezeigt. Seine Antwort auf die Frage, ob die Arbeit von Meredith und Vale belege, dass Gramoxone den FAO-Spezifikationen entspricht, ist unmissverständlich: «Offensichtlich nicht».
Eddleston widerspricht auch der Behauptung, welche Syngenta und seine Vorgängerfirmen im Laufe der Jahre immer wieder geäussert haben: dass Menschen, die mit Paraquat Suizidversuche begehen, meist so grosse Mengen zu sich nehmen würden, dass ohnehin kein Brechmittel sie retten könnte. «Viele Menschen, vor allem jüngere, nehmen sehr kleine Mengen an Gift ein», erklärt Eddleston, der gemäss eigenen Aussagen bereits «Dutzende, wenn nicht Hunderte» Menschen an Pestizidvergiftungen hat sterben sehen.
Viele Vergiftungsopfer lebten noch während mehreren Tagen, sagt er, «sie können mit Ihnen sprechen, Ihnen erzählen, was geschehen ist. Und oft hatten sie überhaupt keinen Willen zu sterben.»
Selbst wenn man Paraquat, etwas «weniger gefährlich machen» könne – «sicher kann man es nicht machen», sagt Eddleston.
«Die einzige Lösung ist es, Paraquat zu verbieten»

In den frühen 2000er-Jahren seien in Sri Lanka zeitweise «ein Drittel der Spitalbetten von Menschen mit Pestizidvergiftungen belegt» gewesen, sagt Dr Shaluka Jayamanne, Dozent an der medizinischen Fakultät der Universität Kelaniya. Dann wurden Paraquat und die giftigsten Organophosphat-Insektizide verboten. Daraufhin seien «die pestizidbedingten Todesfälle» und damit auch die Belastung der Krankenhäuser stark zurückgegangen.
Doch anderswo wird immer noch mit Paraquatvergiftungen gekämpft; im indischen Bundesstaat Odisha zum Beispiel. Im September 2019 traten Ärzt*innen aus der Stadt Burla in einen Hungerstreik. Sie forderten ein Verbot von Paraquat. Medienberichten zufolge waren in den zwei Jahren davor 177 Patient*innen nach Paraquatvergiftungen in ihr Krankenhaus in Burla eingeliefert worden. 170 waren gestorben.
Der von Unearthed und Public Eye kontaktierte Arzt Dr. Shankar Ramchandani, der am Streik teilnahm, zeigt sich tief besorgt. Obwohl die Regierung von Odisha den Einsatz von Paraquat inzwischen eingeschränkt habe, «kommen nach wie vor Patienten». «Viele Patienten sterben und wir können nichts tun, weil es kein Gegenmittel gibt».
Für Dr. Shankar Ramchandani ist klar:
«Die einzige Lösung ist es, Paraquat zu verbieten».
Disclaimer
Gemeinsame Recheche von Unearthed und Public Eye, zusätzliche Reportage in Sri Lanka: Shalini Wickramasuriya. Autoren: Laurent Gaberell und Crispin Dowler, Übersetzung: Carla Hoinkes und Timo Kollbrunner.
Haftungsausschluss: Diese Version ist gekürzt und eine Übersetzung der englischen Originalfassung. Im Falle von Abweichungen ist einzig das Original auf Englisch massgeblich.
Die Recherche wurde auch in Französisch und Spanisch übersetzt.